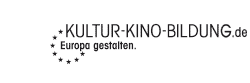Teuer errungen
Teil 1: Leitartikel – Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss bleiben – und besser werden

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) steht zu Recht vielfach in der Kritik. Zuallererst einmal ist er ziemlich teuer. Viele vor allem junge Menschen ärgern sich, dass sie dafür bezahlen müssen, obwohl sie ihn zunehmend weniger konsumieren. Bürgergeldbeziehende haben glücklicherweise die Möglichkeit, sich von den Gebühren befreien zu lassen. Das sieht bei Haushalten mit geringen Einkommen schon ganz anders aus. Bei steigenden Kosten und Lohndruck zählt in vielen Familien und Wohngemeinschaften jeder Euro und muss zweimal umgedreht werden, um über die Runden zu kommen. Und dann noch per Staatsvertrag für etwas zahlen, was unter Umständen gar nicht in Anspruch genommen wird?
Teuer und trivial
Dazu kommt die inhaltliche Kritik. Zu viel triviale Unterhaltung von vorgestern, zu viele Nebenschauplätze, schlecht recherchierter Lokaljournalismus, aber auch das Transportieren von Staatsräson in den überregionalen Formaten, lauten die Vorwürfe an den ÖRR. Und das alles mit öffentlichen Geldern.
Beim Thema Geld und Ressourcenverwendung kommt der ÖRR vielfach gar nicht gut weg. Tatsächlich gibt es zahlreiche nachweisbare Beispiele für verschwenderische Haushaltspolitik in der schier unüberschaubaren ÖRR-Senderfamilie, ebenso für Vetternwirtschaft und die Überversorgung von Leitungspersonal.
Luxusgehälter
Dazu kommen fragliche Personalentscheidungen nicht zuletzt unter politischer Einflussnahme, Versagen sowie krasses Fehlverhalten von Senderchefs und -chefinnen, die frei von jedem unternehmerischen Risiko zudem Gehälter beziehen, für die ein Großteil der Gebührenzahler bestenfalls Kopfschütteln übrig hat. Das macht zu Recht wütend.
Auch die Rentenbezüge der Intendanten sind alles andere als von schlechten Eltern, während die Altersarmut in der Breite zunimmt und es im aktuellen Rechtsruck Bestrebungen gibt, die Rente weiter zu schleifen.
Rechte Motive
Aber Vorsicht: Was wäre die Alternative? Und was sind die Motive derjenigen, die dem ÖRR pauschal Staatsgehorsam und Indoktrination vorwerfen und sogar dessen Abschaffung verlangen oder versprechen? Auch hier weht der Wind in vielen Fällen von rechts, wo es letztlich darum geht, sozialkritische Formate abzuschaffen und die Medien dann im privaten Bereich nach und nach gleichzuschalten.
Dieser Art von Kritik muss aus demokratischer Sicht deutlich widersprochen werden, sie ist gefährlich und geht in die völlig falsche Richtung. Vergessen wir nicht, dass auch Formate wie „Die Anstalt“, die „heute show“ oder das „Comedy Kollektiv“ zum ÖRR gehören, die nun wirklich kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn es darum geht, auf unterschiedliche Weise das Regierungshandeln und damit verbundene soziale Missstände zu kritisieren. Auch wäre es wirklich unfair, alle zum Beispiel freien Mitarbeitenden in den Lokalredaktionen des ÖRR abzuwatschen, obwohl viele mit ihren gut recherchierten Berichten und Reportagen zum öffentlichen Diskurs beitragen und deren Arbeit soziale Themen aufgreift, die einen unbedingten Nachrichtenwert haben.
Demokratisch wertvoll
Der Zwang, Gebühren zu zahlen, ist mehr als fragwürdig, da braucht es eine andere Lösung. Die Strukturen sind vielfach verkrustet, da braucht es Reformen und Transparenz. Und über die Programme kann diskutiert werden, sie dürfen ruhig moderner werden. Trotzdem muss der ÖRR erhalten bleiben, er ist eine politische Errungenschaft!
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 Branchenprobleme
Branchenprobleme
Intro – Gut informiert
 von ch-thema-s2-678.jpg) „Die Sender sind immer politisch beeinflusst“
„Die Sender sind immer politisch beeinflusst“
Teil 1: Interview – Medienforscher Christoph Classen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
 von ch-thema-s3-678.jpg) Aus den Regionen
Aus den Regionen
Teil 1: Lokale Initiativen – Das WDR-Landesstudio Köln
 von tr-thema-s1-678.jpg) An den wahren Problemen vorbei
An den wahren Problemen vorbei
Teil 2: Leitartikel – Journalismus vernachlässigt die Sorgen und Nöte von Millionen Menschen
 von tr-thema-s2-678.jpg) „Das Gefühl, Berichterstattung habe mit dem Alltag wenig zu tun“
„Das Gefühl, Berichterstattung habe mit dem Alltag wenig zu tun“
Teil 2: Interview – Medienwissenschaftlerin Marlis Prinzing über Haltung und Objektivität im Journalismus
 von tr-thema-s3-678.jpg) Von lokal bis viral
Von lokal bis viral
Teil 2: Lokale Initiativen – Die Landesanstalt für Medien NRW fördert Medienvielfalt
 von en-thema-s1-678.jpg) Journalismus im Teufelskreis
Journalismus im Teufelskreis
Teil 3: Leitartikel – Wie die Presse sich selbst auffrisst
 von en-thema-s2-678.jpg) „Nicht das Verteilen von Papier, sondern Journalismus fördern“
„Nicht das Verteilen von Papier, sondern Journalismus fördern“
Teil 3: Interview – Der Geschäftsführer des DJV-NRW über die wirtschaftliche Krise des Journalismus
 von en-thema-s3-678.jpg) Pakt mit dem Fakt
Pakt mit dem Fakt
Teil 3: Lokale Initiativen – Das Zentrum für Erzählforschung an der Uni Wuppertal
 von chtren-thema-europa-678.jpg) Nicht mit Rechten reden
Nicht mit Rechten reden
Der „cordon sanitaire médiatique“ gibt rechten Parteien keine Bühne – Europa-Vorbild Wallonien
 von chtren-thema-glosse-678.jpg) Der Vogelschiss der Stammesgeschichte
Der Vogelschiss der Stammesgeschichte
Wenn Menschenrechte gleich Lügenpresse sind – Glosse
Drehtür in den Klimakollaps
Teil 1: Leitartikel – Hinter mächtigen Industrieinteressen wird die Klimakrise zum Hintergrundrauschen
Welt statt Wahl
Teil 2: Leitartikel – Klimaschutz geht vom Volke aus
Die Hoffnung schwindet
Teil 3: Leitartikel – Die Politik bekämpft nicht den Klimawandel, sondern Klimaschützer:innen
Worüber sich (nicht) streiten lässt
Teil 1: Leitartikel – Wissenschaft in Zeiten alternativer Fakten
Mieter aller Länder, vereinigt euch!
Teil 2: Leitartikel – Der Kampf für bezahlbares Wohnen eint unterschiedlichste Milieus
Noch einmal schlafen
Teil 3: Leitartikel – Ab wann ist man Entscheider:in?
Gerechtigkeit wäre machbar
Teil 1: Leitartikel – Die Kluft zwischen Arm und Reich ließe sich leicht verringern – wenn die Politik wollte
Gleiches Recht für alle!
Teil 2: Leitartikel – Aufruhr von oben im Sozialstaat
Die Mär vom Kostenhammer
Teil 3: Leitartikel – Das Rentensystem wackelt, weil sich ganze Gruppen der solidarischen Vorsorge entziehen
Herren des Krieges
Teil 1: Leitartikel – Warum Frieden eine Nebensache ist
Streiken statt schießen
Teil 2: Leitartikel – Das im Kalten Krieg entwickelte Konzept der Sozialen Verteidigung ist aktueller denn je.
Unser höchstes Gut
Teil 3: Leitartikel – Von Kindheit an: besser friedensfähig als kriegstüchtig
Inspiration für alle
Teil 1: Leitartikel – Wer Kunst und Kultur beschneidet, raubt der Gesellschaft entscheidende Entwicklungschancen
Unbezahlbare Autonomie
Teil 2: Leitartikel – Die freie Theaterszene ist wirtschaftlich und ideologisch bedroht