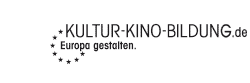Verklärte Idylle
Ein Kommentar zur Debatte um den doppelten Abijahrgang – Thema 10/13 Arme Mater
Irgendwann während meiner Studienzeit in den frühen Nullerjahren erzählte mir ein Bekannter eine Anekdote. In der ersten Vorlesung des ersten Semesters habe der Dozent den anwesenden Studierenden der Germanistik Folgendes für ein erfolgreiches Bestehen ihres Studiums geraten: „Bleiben Sie zwei Jahre im Bett und lesen Sie ein paar Bücher.“ Es ist eine dieser Geschichten, deren Vieldeutigkeit man erst später im Leben versteht. Denn oberflächlich betrachtet ist der Rat ja nicht dumm. Als Germanist sollte man ein paar Bücher gelesen haben, am besten auch noch „die richtigen“ – also Goethe, Wieland, Marx und Arno Schmidt und dann am besten auch noch die im Dekadentakt wechselnden Theoretiker, die diesen Kanon regelmäßig wiederbeleben. Zwei Jahre dürften dafür zwar nicht ausreichen, aber es ist ein Anfang.
Witz auf Kosten einer Minderheit
Aber wenn man ein wenig ehrlich ist, dann wird einem auch klar, dass dieser Witz auf Kosten einer im Raum anwesenden Minderheit geht: derjenigen Studierenden, bei denen zwei Jahre konzentrierte Lektüre ohne Scheinerwerb mit dem Entzug der BAFöG-Leistungen bestraft würde. Das sind an deutschen Unis immerhin 617.000 Studierende, und ein nicht geringer Teil von diesen dürfte zu denen gehören, die keine Akademiker-Eltern haben.
Was aber hat das alles mit dem doppelten Abijahrgang zu tun? Schaut man zurück auf die Debatte um die Einführung des acht Jahre dauernden Gymnasiums, dann sticht eine Argumentation gegen die Verkürzung besonders heraus. Acht Jahre Gymnasium überfordere die Schüler, ihnen bliebe keine Zeit für die wichtigen Erfahrungen Heranwachsender – Arno Schmidt zu lesen zum Beispiel. Stattdessen züchte man sich eine Generation angepasster, auf Leistung getrimmter Jugendlicher heran, denen kritisches Denken systematisch ausgetrieben werde. Es ist eine Variation über ein Thema. Denn wie so häufig in Deutschland zeigt sich erst in der Debatte, wer sie eigentlich führt, und wer dort mit wem spricht. Die ausgeschlossenen Dritten der G8-Debatte sind diejenigen, die durch unser hochselektives Bildungswesen systematisch davon ferngehalten werden, das, was die G8-Gegner als „kritisches Denken“ bezeichnen, überhaupt erwerben zu dürfen.
Diese Verengung der Debatte hat eine lange Tradition. Erzählungen über das Studentenleben 1968ff sind Legion, diejenigen über die Lehrlingsbewegung im gleichen Jahr dagegen selten. Und wenn der bildungsbürgerliche Nachwuchs mal wieder erfolgreich gegen Studiengebühren protestiert, ist nur eine Minderheit bereit, die Forderung nach „freier Bildung für alle“ auch auf Kindergärten auszudehnen. Und so setzen sich auch in der Debatte um das G8-Gymnasium die „verdeckten Verletzungen von Klassenzugehörigkeit“ (Richard Sennett) fort. Wer die eigene Schulzeit mit neun Jahren Gymnasium zur bildungspolitischen Idylle verklärt, der mag sich zwar ehrlich und aufrichtig um die Folgen für die Schüler sorgen. Aber sollte dann auch so ehrlich zuzugeben, dass es sich dabei zuerst um den Nachwuchs der eigenen Schicht handelt.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 Der doppelte Normalzustand
Der doppelte Normalzustand
Die Kölner Hochschulen und der zweifache Abijahrgang – THEMA 10/13 ARME MATER
 „Es ist sowieso schon voll“
„Es ist sowieso schon voll“
Pressesprecher Patrick Honecker über die Situation an der Uni Köln – Thema 10/13 Arme Mater
 Auf in die Freiwilligkeit
Auf in die Freiwilligkeit
Der Andrang auf die Freiwilligendienste des Bundes – Thema 10/13 Arme Mater
Perfektes Versagen
Intro – Systemstörung
Drehtür in den Klimakollaps
Teil 1: Leitartikel – Hinter mächtigen Industrieinteressen wird die Klimakrise zum Hintergrundrauschen
„Kernziel der Klimaleugner: weltweite Zusammenarbeit zerstören“
Teil 1: Interview – Politologe Dieter Plehwe über die Anti-Klimaschutz-Bewegung
Dem Klima verpflichtet
Teil 1: Lokale Initiativen – Die Initiative Klimawende Köln
Welt statt Wahl
Teil 2: Leitartikel – Klimaschutz geht vom Volke aus
„Nicht versuchen, die Industrie des 19. Jahrhunderts zu retten“
Teil 2: Interview – Meteorologe Karsten Schwanke über Klimaschutz und wirtschaftliche Chancen
Klimaschutz braucht (dein) Engagement
Teil 2: Lokale Initiativen – Die Bochumer Initiative BoKlima
Die Hoffnung schwindet
Teil 3: Leitartikel – Die Politik bekämpft nicht den Klimawandel, sondern Klimaschützer:innen
„Weit von einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit entfernt“
Teil 3: Interview – Die Rechtswissenschaftlerin Lisa Kadel über die Kriminalisierung von Klimaaktivist:innen
Klimaprotest im Wandel
Teil 3: Lokale Initiativen – Extinction Rebellion in Wuppertal
Klimaschutz als Bürgerrecht
Norwegen stärkt Engagement für Klimaschutz – Europa-Vorbild: Norwegen
Durch uns die Sintflut
Der nächste Weltuntergang wird kein Mythos sein – Glosse
Vorwärts 2026
Intro – Kopf oder Bauch?
Worüber sich (nicht) streiten lässt
Teil 1: Leitartikel – Wissenschaft in Zeiten alternativer Fakten
„Dass wir schon so viel wissen, ist das eigentliche Wunder“
Teil 1: Interview – Neurowissenschaftlerin Maria Waltmann über Erforschung und Therapie des Gehirns
Über Grenzen hinweg entscheiden
Teil 1: Lokale Initiativen – Das Experimentallabor Decision Lab Cologne
Mieter aller Länder, vereinigt euch!
Teil 2: Leitartikel – Der Kampf für bezahlbares Wohnen eint unterschiedlichste Milieus
„Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor“
Teil 2: Interview – Sprachwissenschaftler Thomas Niehr über Sprache in Politik und Populismus
Im Krieg der Memes
Teil 2: Lokale Initiativen – Saegge klärt in Bochum über Populismus auf
Noch einmal schlafen
Teil 3: Leitartikel – Ab wann ist man Entscheider:in?
„Zwischen Perfektionismus und Ungewissheit“
Teil 3: Interview – Psychiater Volker Busch über den Umgang mit schwierigen Entscheidungen
Weil es oft anders kommt
Teil 3: Lokale Initiativen – Gut aufgestellt in Wuppertal: Pro Familia berät zu Schwangerschaft, Identität und Lebensplanung