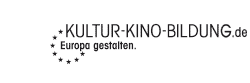Widerstand ohne Waffen
Teil 2: Lokale Initiativen – Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen und ihr Landesverband NRW

Wer Frieden fordert, erntet oft Skepsis. Naiv und weltfremd nennt man Pazifist:innen gerne. Rufe nach Aufrüstung und Kriegstüchtigkeit gelten mittlerweile wieder als selbstverständlich, hingegen gilt das Bekenntnis zur Gewaltfreiheit manchen sogar als gefährlich. Vor Initiativen wie der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegner:innen (DFG-VK) liegt ein gewaltiger Berg Arbeit, wenn Militarisierung den politischen Dialog prägt, die Mehrheit der Deutschen eine Rückkehr zur Wehrpflicht befürwortet und der Anblick von Soldat:innen an Schulen sowie in Bussen und Bahnen zunehmend alltäglich wird.
Frühe Anfänge
Es ist bei weitem nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Pazifist:innen in Deutschland gegen den Strom schwimmen müssen. 1892 gegründet, machte die Deutsche Friedensgesellschaft (DFG) mit Beginn des Ersten Weltkriegs frühe Erfahrungen mit politischer Verfolgung. Viele Mitglieder lösten sich von ihren pazifistischen Überzeugungen, andere flohen ins Exil. Zur Weimarer Zeit wuchs die Organisation auf über 30.000 Mitglieder, bevor sie nach Hitlers Machtübernahme verboten wurde. 1974 verbanden sich die DFG und der 1958 gegründete Verband der Kriegsdienstverweigerer (VK) zur DFG-VK. Der nordrheinwestfälische Landesverband ist in Dortmund ansässig.
Neue Methoden
Wenn es um Gegenrede in Zeiten des Militarismus geht, können die Mitglieder also auf einer langen Tradition aufbauen, setzen aber gleichzeitig auf Methodenvielfalt bei der praktischen Umsetzung ihrer Überzeugungen: Neben Klassikern wie den Ostermärschen organisierte der Landesverband im August eine Friedens-Fahrradtour, um eine Woche lang an verschiedenen Militärstandorten zwischen Köln und Cochem zu protestieren. Beratung und Unterstützung für Kriegsdienstverweiger:innen werden ebenfalls angeboten. Auf der Webseite verweigern.info bekommen Menschen, die über eine Verweigerung nachdenken, anhand eines kurzen Fragebogens eine Einschätzung, ob das derzeit eine sinnvolle Entscheidung für sie ist.
Eine Idee aus den 70ern
In der Debatte, ob Aufrüstung die einzig angemessene Reaktion auf Aggressionen Russlands sein kann, zieht die DFG-VK auch ein Konzept der Friedensbewegung aus den 70er Jahren heran: Soziale Verteidigung. Die Idee in einem Satz: Wehrhaftigkeit geht auch unbewaffnet. Was zunächst paradox klingen mag, begründen Anhänger:innen der Sozialen Verteidigung – kurz gesagt – mit der Überzeugung, dass eine Besatzungsmacht wenig ausrichten kann, wenn die Bevölkerung des eingenommenen Territoriums zwar dialogbereit bleibt, sich aber beharrlich weigert, den Befehlen der Besatzungsmacht Folge zu leisten, Kooperation verweigert und so gleichsam den Preis für die Besatzung so weit in die Höhe treibt, dass sie sich nicht lohnt.
Friedenslogik und Soziale Verteidigung
In Dortmund wurde das Konzept im Frühling 2024 ergebnisoffen diskutiert. Ganz warm geworden ist man damals nicht damit. Ein dazu veröffentlichtes Papier betont ein Vorgehen im Sinne einer „Friedenslogik“, die den Gegner immer auch als Partner verstehe, mit dem ein Interessenausgleich zu suchen sei – während Soziale Verteidigung den Gegner grundsätzlich als Feind verstehe, dessen Erfolg zu verhindern sei. Das Papier fasst aber auch zusammen, dass sowohl Friedenslogik als auch Soziale Verteidigung der „angeblichen Alternativlosigkeit“ militärischen Denkens entgegenstehen.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 Konflikt-Kanzler
Konflikt-Kanzler
Intro – Friedenswissen
 von ch-thema-s1-678.jpg) Herren des Krieges
Herren des Krieges
Teil 1: Leitartikel – Warum Frieden eine Nebensache ist
 von ch-thema-s2-678.jpg) „Besser fragen: Welche Defensivwaffen brauchen wir?“
„Besser fragen: Welche Defensivwaffen brauchen wir?“
Teil 1: Interview – Philosoph Olaf L. Müller über defensive Aufrüstung und gewaltfreien Widerstand
 von ch-thema-s3-678.jpg) Politische Körper
Politische Körper
Teil 1: Lokale Initiativen – Das Kölner Friedensbildungswerk setzt auf Ganzheitlichkeit
 von tr-thema-s1-678.jpg) Streiken statt schießen
Streiken statt schießen
Teil 2: Leitartikel – Das im Kalten Krieg entwickelte Konzept der Sozialen Verteidigung ist aktueller denn je.
 von tr-thema-s2-678.jpg) „Als könne man sich nur mit Waffen erfolgreich verteidigen“
„Als könne man sich nur mit Waffen erfolgreich verteidigen“
Teil 2: Interview – Der Ko-Vorsitzende des Bundes für Soziale Verteidigung über waffenlosen Widerstand
 von en-thema-s1-678.jpg) Unser höchstes Gut
Unser höchstes Gut
Teil 3: Leitartikel – Von Kindheit an: besser friedensfähig als kriegstüchtig
 von en-thema-s2-678.jpg) „Das ist viel kollektives Erbe, das unfriedlich ist“
„Das ist viel kollektives Erbe, das unfriedlich ist“
Teil 3: Interview – Johanniter-Integrationsberaterin Jana Goldberg über Erziehung zum Frieden
 von en-thema-s3-678.jpg) Platz für mehrere Wirklichkeiten
Platz für mehrere Wirklichkeiten
Teil 3: Lokale Initiativen – Kamera und Konflikt: Friedensarbeit im Medienprojekt Wuppertal
 von chtren-thema-europa-678.jpg) Kinder verkünden Frieden
Kinder verkünden Frieden
Das Projekt „Education for a Culture of Peace“ – Europa-Vorbild: Zypern
 von chtren-thema-glosse-678.jpg) Brauerheer statt Bundeswehr
Brauerheer statt Bundeswehr
Wie ein Biertornado die Gewaltspirale aus dem Takt wirft – Glosse
Rauf mit der Hemmschwelle
Teil 1: Lokale Initiativen – Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Köln
Eine bessere Zukunft
Teil 2: Lokale Initiativen – Die Frauenberatungsstelle Duisburg
Raus aus der Grauzone
Teil 3: Lokale Initiativen – Solidarisch und unbeirrbar: Wuppertals Frauenverband Courage
Dem Klima verpflichtet
Teil 1: Lokale Initiativen – Die Initiative Klimawende Köln
Klimaschutz braucht (dein) Engagement
Teil 2: Lokale Initiativen – Die Bochumer Initiative BoKlima
Klimaprotest im Wandel
Teil 3: Lokale Initiativen – Extinction Rebellion in Wuppertal
Über Grenzen hinweg entscheiden
Teil 1: Lokale Initiativen – Das Experimentallabor Decision Lab Cologne
Im Krieg der Memes
Teil 2: Lokale Initiativen – Saegge klärt in Bochum über Populismus auf
Weil es oft anders kommt
Teil 3: Lokale Initiativen – Gut aufgestellt in Wuppertal: Pro Familia berät zu Schwangerschaft, Identität und Lebensplanung
Gegen die Vermüllung der Stadt
Teil 1: Lokale Initiativen – Umweltschutz-Initiative drängt auf Umsetzung der Einweg-Verpackungssteuer
Klassenkampf im Quartier
Teil 2: Lokale Initiativen – Bochums Stadtteilgewerkschaft Solidarisch in Stahlhausen
Der Kitt einer Gesellschaft
Teil 3: Lokale Initiativen – Der Landesverband des Paritätischen in Wuppertal