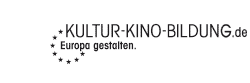Verdichtete Unterschiedlichkeit
Das Agnesviertel ist ein typisches Beispiel für Kölner Urbanität – Thema 11/12 Neue Urbanität
Auch im Agnesviertel gibt es die bekannte Abfolge von Pionierphase und Verdrängung. Nachdem in den 1970ern Künstlerateliers entstanden, die Alte Feuerwache zum Kulturzentrum verwandelt wurde und alter Hausbestand durch Besetzungen und Genossenschaften vorm Abriss bewahrt werden konnte, zählt es heute zum teuersten Pflaster Kölns. Die nicht verbürgerlichten Pioniere oder Verlierer dieser Aufwertung haben das Quartier verlassen oder wurden verdrängt.
Das Besondere am Agnesviertel sind seine „verdichtete Unterschiedlichkeit“ und seine Lage mit kurzen Laufwegen und Grünflächen, die es als Wohnviertel interessant machen. Doch im Gegensatz zu Ehrenfeld oder dem Belgischen Viertel nutzen es vorwiegend Leute aus dem Viertel selbst zum Ausgehen. Die Boheme und die Kunstwelt haben sich hier nie richtig wohlgefühlt. Das schärft den Blick auf die eigentliche Aufwertung: die Inwertsetzung durch die Immobilienwirtschaft. Neuvermietungen an der Obergrenze des Mietspiegels sind die Regel, bei Mieterwechsel verdoppeln sich so teilweise die Mieten. Das hat unmittelbare Verdrängungs- und Homogenisierungseffekte. Werden Mehrfamilienhäuser in Eigentumswohnungen umgewidmet, ändern sich zudem die Ansprüche der Bewohner – eine Verspießerung setzt ein.
Die oberen Ränge haben sich schon in Stellung gebracht
Dieser Prozess ist an sich entpolitisierend. Wo Unbehagen, Wut und Verdrängungsängste auf Immobilienmarktakteure stoßen, lauert entweder die Letztbegründung „Markt“ oder ein individualrechtliches Manöver, das den Einzelnen in die Defensive zwingt. Es fehlt eine kollektivrechtliche Dimension, die Solidaritätsformen unter den Betroffenen schafft. Henri Lefebvre nennt das „Recht auf Stadt“. Aber diese Forderung entzündet sich zumeist an Räumen, in denen mehr als nur Wohnen auf dem Spiel steht. Im Agnesviertel, in dem nur vereinzelt Gebäude leer stehen, gibt es keine Brachen und Bauprojekte, an denen sich ein solches „Recht auf Stadt“ entzünden könnte. Die für 2018 geplante Umgestaltung des Ebertplatzes birgt da noch am meisten Potential.
Die oberen Ränge haben sich aber schon in Stellung gebracht. Angeführt vom Verein „Unternehmer für die Region Köln e.V.“ und flankiert von biederkölschen Bürgerinitiativen wurde von Albert Speer ein „Masterplan Köln“ entwickelt, der Köln als Investitionsstandort attraktiver machen soll. Für den Ebertplatz ist vorgesehen, die schon vor Jahren begonnene „transparente“ Gestaltung des Platzes weiter zu radikalisieren. So wird die „Badewanne“ des Ebertplatzes bis 2018 aufgeschüttet, Obdachlose, Arbeitslose oder Dealer etc. also endgültig vertrieben. Bis dahin lässt man die afrikanische Kneipe und die Künstler, die die Passage für sich als stadtpolitisches Projekt entdecken, noch ein bisschen weiter toben, „entmietet“ den Platz aber, indem man Rolltreppen verrotten lässt und auch sonst keine Reparaturen mehr vornimmt – so lange, bis der letzte Zweifler nachgibt und sagt: „Schüttet zu das Loch!“
Weitere Artikel zum Thema in unseren Partnermagazinen:
www.trailer-ruhr.de/vom-kulturbiotop-zum-szeneviertel
www.engels-kultur.de/kulturstadt-im-tal
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 „Erdig, nahbar, ehrlich“
„Erdig, nahbar, ehrlich“
Das Performance-Duo Katze und Krieg über „Alles wirklich“ im öffentlichen Raum – Premiere 06/25
 Augenöffner im Autohaus
Augenöffner im Autohaus
„The Mystery of Banksy“ in Köln – Kunstwandel 12/23
 von choices_Thema_Seite 2.jpg) „Das ist eine Konsumhaltung gegenüber der Stadt“
„Das ist eine Konsumhaltung gegenüber der Stadt“
Wie die Stadtwohnung die Villa im Grünen ablöst – Thema 11/12 Neue Urbanität
 Rechts vom Rhein geht’s weiter
Rechts vom Rhein geht’s weiter
In Kalk wächst die Subkultur in Hinterhöfen und Vorstadtkneipen – Thema 11/12 Neue Urbanität
 Urban es en Jeföhl
Urban es en Jeföhl
Was ist eigentlich die „neue Urbanität“? – THEMA 11/12 NEUE URBANITÄT
Erschütternd normal
Intro – Gegenwehr
Glaube und Geld
Teil 1: Leitartikel – Gegen den milliardenschweren Kulturkampf der rechten Christen hilft kein Beten
„Man darf auswählen, wem man sich unterwerfen will“
Teil 1: Interview – Religionssoziologe Gert Pickel über christliche Influencer
Rauf mit der Hemmschwelle
Teil 1: Lokale Initiativen – Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Köln
Die Gefahr im eigenen Zuhause
Teil 2: Leitartikel – Gewalt gegen Frauen nimmt zu und betrifft die ganze Gesellschaft
„Es wird versucht, das Strafrecht als politisches Mittel zu nutzen“
Teil 2: Interview – Juristin Susanne Beck über Gewalt gegen Frauen
Eine bessere Zukunft
Teil 2: Lokale Initiativen – Die Frauenberatungsstelle Duisburg
Lebensrealität anerkennen
Teil 3: Leitartikel – Schwangerschaftsabbrüche zwischen Strafrecht und Selbstbestimmung
„Es geht um Kontrolle über Menschen, die schwanger werden können“
Teil 3: Interview – Medizinerin Alicia Baier zum Streit über Schwangerschaftsabbrüche
Raus aus der Grauzone
Teil 3: Lokale Initiativen – Solidarisch und unbeirrbar: Wuppertals Frauenverband Courage
Sensibel verzahnte Reformen
Wie Portugal Maßstäbe bei der Bekämpfung von Gewalt an Frauen setzt – Europa-Vorbild: Portugal
Der Kanzler und Hegel
Jetzt ist aber auch mal gut mit diesem ganzen Minderheitengedöns! – Glosse
„Die Wut unserer Generation ist keine Laune!“
Menschenrechts-Aktivistin Jennifer Follmann über den Frauenstreik zum 9. März
Perfektes Versagen
Intro – Systemstörung
Drehtür in den Klimakollaps
Teil 1: Leitartikel – Hinter mächtigen Industrieinteressen wird die Klimakrise zum Hintergrundrauschen
„Kernziel der Klimaleugner: weltweite Zusammenarbeit zerstören“
Teil 1: Interview – Politologe Dieter Plehwe über die Anti-Klimaschutz-Bewegung
Dem Klima verpflichtet
Teil 1: Lokale Initiativen – Die Initiative Klimawende Köln
Welt statt Wahl
Teil 2: Leitartikel – Klimaschutz geht vom Volke aus
„Nicht versuchen, die Industrie des 19. Jahrhunderts zu retten“
Teil 2: Interview – Meteorologe Karsten Schwanke über Klimaschutz und wirtschaftliche Chancen
Klimaschutz braucht (dein) Engagement
Teil 2: Lokale Initiativen – Die Bochumer Initiative BoKlima