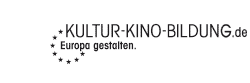Wurzeln des Krieges
Die Kriegsschuld-Debatte feiert ein Jubiläum und ein Revival – Thema 01/14 Krieg
2014 steht ganz im Zeichen des 100-jährigen „Jubiläums“ von „1914“. Im Windschatten des Großevents gibt es ein anderes, kleineres Jubiläum, das bis heute viel über Interpretationshoheit und Geschichtspolitik verrät. 1964 hatte das Goethe-Institut den deutschen Historiker Fritz Fischer zu einer Vortragsreise in die USA eingeladen, doch dann strich der damalige Bundesaußenminister Gerhard Schröder (CDU) die zugesagten Zuschüsse ersatzlos. Der Grund: Fischer galt unter der nationalkonservativen Historikerelite der bundesdeutschen 1960er Jahre als Nestbeschmutzer, denn er hatte einen Konsens in Frage gestellt. Fischer hatte mithilfe seiner Assistenten eine ausgiebige Quellenforschung über die deutsche Rolle beim Ausbruch des ersten Weltkriegs betrieben. Seine These bestand darin, dassDeutschland keineswegs in den Krieg hineingeschliddert war, wie es die Mehrheit seiner Kollegen damals vertrat. Vielmehr nutzte es den Konflikt mit Russland und Frankreich zum „Griff nach der Weltmacht“. Fischers Reise nach drüben wurde dann privat finanziert, seine Sicht ist inzwischen weithin akzeptiert. Allerdings: Fischer selbst hat nie von einer deutschen „Alleinschuld“ geschrieben, sondern dem deutschen Reich nur „einen erheblichen Teil der historischen Verantwortung“ angelastet. Für die Zuspitzung sorgte die veröffentlichte Meinung.
Wieder fünfzig Jahre später erregt die Medien erneut ein Buch über „1914“. Der in Cambridge lehrende Historiker Christopher Clark variiert in seinem zielgenau publizierten Titel „Die Schlafwandler“ die alte These. In seiner Sicht wird Deutschland entlastet, die Kriegstreiber waren eher Russland und Frankreich. Doch „eine Rangordnung der Staaten nach ihrem jeweiligen Anteil an der Verantwortung für den Kriegsausbruch“ möchte auch er nicht aufzustellen. Gleichwohl gleicht seine Argumentation „verblüffend der deutschen Kriegsunschuld-Diskussion in den 1920er Jahren“, so der Düsseldorfer HistorikerGerd Krumeich. Damals hatte das Auswärtige Amt eine eigene Abteilung eingerichtet, deren einzige Aufgabe im Nachweis der deutschen Unschuld bestand.
Die Fakten sprachen freilich schon damals eine andere Sprache als die offizielle Propaganda und die von ihr entworfenen Bilder der Vergangenheit. Es darf also wieder eine Debatte geführt werden. Sinnvoll wäre es, dazu über die Bezeichnung des Ersten Weltkriegs als „Urkatastrophe“ der westlichen Welt zu streiten. Das Wort suggeriert etwas Schicksalhaftes. Doch Kriege brechen nicht wie eine Flutwelle über die betroffenen Gesellschaften herein. Es ist allemal sinnvoller, die nationalen und nationalistischen Interessen zu benennen, die dem bewaffneten Konflikt vorausgehen und ihn schließlich verursachen.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 Brot und Kriegsspiele
Brot und Kriegsspiele
Köln erinnert sich an den Ersten Weltkrieg – THEMA 01/14 KRIEG
 „In Westeuropa ist der ‚Große Krieg‘ sehr präsent“
„In Westeuropa ist der ‚Große Krieg‘ sehr präsent“
Dr. Bärbel P. Kuhn über Kriegsmuseen, den „Großen Krieg“ und Europa – Thema 01/14 Krieg
Perfektes Versagen
Intro – Systemstörung
Drehtür in den Klimakollaps
Teil 1: Leitartikel – Hinter mächtigen Industrieinteressen wird die Klimakrise zum Hintergrundrauschen
„Kernziel der Klimaleugner: weltweite Zusammenarbeit zerstören“
Teil 1: Interview – Politologe Dieter Plehwe über die Anti-Klimaschutz-Bewegung
Dem Klima verpflichtet
Teil 1: Lokale Initiativen – Die Initiative Klimawende Köln
Welt statt Wahl
Teil 2: Leitartikel – Klimaschutz geht vom Volke aus
„Nicht versuchen, die Industrie des 19. Jahrhunderts zu retten“
Teil 2: Interview – Meteorologe Karsten Schwanke über Klimaschutz und wirtschaftliche Chancen
Klimaschutz braucht (dein) Engagement
Teil 2: Lokale Initiativen – Die Bochumer Initiative BoKlima
Die Hoffnung schwindet
Teil 3: Leitartikel – Die Politik bekämpft nicht den Klimawandel, sondern Klimaschützer:innen
„Weit von einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit entfernt“
Teil 3: Interview – Die Rechtswissenschaftlerin Lisa Kadel über die Kriminalisierung von Klimaaktivist:innen
Klimaprotest im Wandel
Teil 3: Lokale Initiativen – Extinction Rebellion in Wuppertal
Klimaschutz als Bürgerrecht
Norwegen stärkt Engagement für Klimaschutz – Europa-Vorbild: Norwegen
Durch uns die Sintflut
Der nächste Weltuntergang wird kein Mythos sein – Glosse
Vorwärts 2026
Intro – Kopf oder Bauch?
Worüber sich (nicht) streiten lässt
Teil 1: Leitartikel – Wissenschaft in Zeiten alternativer Fakten
„Dass wir schon so viel wissen, ist das eigentliche Wunder“
Teil 1: Interview – Neurowissenschaftlerin Maria Waltmann über Erforschung und Therapie des Gehirns
Über Grenzen hinweg entscheiden
Teil 1: Lokale Initiativen – Das Experimentallabor Decision Lab Cologne
Mieter aller Länder, vereinigt euch!
Teil 2: Leitartikel – Der Kampf für bezahlbares Wohnen eint unterschiedlichste Milieus
„Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor“
Teil 2: Interview – Sprachwissenschaftler Thomas Niehr über Sprache in Politik und Populismus
Im Krieg der Memes
Teil 2: Lokale Initiativen – Saegge klärt in Bochum über Populismus auf
Noch einmal schlafen
Teil 3: Leitartikel – Ab wann ist man Entscheider:in?
„Zwischen Perfektionismus und Ungewissheit“
Teil 3: Interview – Psychiater Volker Busch über den Umgang mit schwierigen Entscheidungen
Weil es oft anders kommt
Teil 3: Lokale Initiativen – Gut aufgestellt in Wuppertal: Pro Familia berät zu Schwangerschaft, Identität und Lebensplanung
Keine Politik ohne Bürger
Wie Belgien den Populismus mit Bürgerräten und Dialogforen kontert – Europa-Vorbild: Belgien