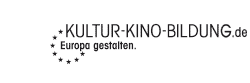Das Unsagbare sagbar machen
José F.A. Oliver erhält Heinrich-Böll-Literaturpreis – Literatur 12/21
Er sei ein Menschenfreund, einer der herausragendsten Lyriker und Essayisten unserer Zeit, seine Werke reich an Sprachmagie und von analytischer Prägnanz. Mit diesen Worten küren die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker und die Jury des Heinrich-Böll-Literaturpreises den diesjährigen Preisträger José Oliver. Der 1961 in Hausach im Schwarzwald geborene Autor bringt in seinen Gedichten, Essays und Kurzprosa das Nomadische seiner andalusischen Heimat, Themen zu Migration und Integration sowie kulturpolitische Themen zur Sprache. Doch auch vermeintlich Unsagbares – das, was zwischen dem Geschriebenen oder Gesagten passiert – schafft Oliver auf beeindruckende Weise sagbar zu machen und den Leser in die Kraft des Nicht-Wortes hineinspüren zu lassen.
Oliver ist Beobachter, Aufklärer und Vermittler zugleich. Dass die Wurzeln dieser Funktionen durch seine Kindheit und seine Eltern, die aus Andalusien damals in den Schwarzwald kamen, mit seiner Sprachmagie eng verbunden sind, liegt nahe. „Du musst auf die Wörter schauen, dann erzählen sie dir eine Geschichte!“, lehrte ihn schon seine Mutter. Doch auch sein Vater, ein ehemaliger Gastarbeiter aus dem andalusischen Málaga, beherrschte das Spiel mit den Wörtern. Oliver ist ein Poet der Gastfreundschaft und wandert dichterisch zwischen spanischer Kultur, Temperament und Anekdoten aus seiner Familie die Zeilen auf und ab. Mal erzählend, mal singend. Seinen Vater würdigt er in dem Gedicht „Vaterskizze – ein Kühlschrank-Betracht“ als besonderen Gastgeber und huldigt darin auch einer der ersten Gerätschaften, die er in Deutschland besaß: dem Kühlschrank. Ein simples Manifest, stets und zu jeder Zeit Gäste in Empfang zu nehmen. Bei dieser rührseligen und unterhaltsamen Hommage hat man gleich ein wohliges Gefühl in Geist und Magen.
Die große Gabe der „Meersprachigkeit“
Doch nicht nur seine Werke zeugen von immenser Bedeutung, besonders in unserer heutigen Zeit, auch Oliver selbst schien schon in frühen Jahren seiner Zeit voraus zu sein. Nicht unwesentlich ist hierbei sein bilingualer Hintergrund, oder wie er es lyrisch beschreibt: seine Meersprachigkeit. Das Gendern sei für ihn dadurch schon immer selbstverständlich gewesen – und auch, wenn in modernen Diskursen von der „Woher kommst du?"-Frage zurecht abgeraten wird, so scheint Oliver diesen Teil seiner Geschichte in seinen Werken und in seinem ganzen Habitus besonders zu akzentuieren und als eine große Gabe gekonnt einzusetzen.
Am Donnerstagabend vor der offiziellen Preisvergabe im Wallraf-Richartz-Museum sitzt Oliver voller Lebensfreude und Selbstironie über den reichen Schatz seiner Werke gebeugt in der Zentral-Bibliothek, in der auch das Heinrich-Böll-Archiv beheimatet ist. Er liest an diesem Abend aus seinen Essays und Gedichten und lässt dabei Magie im ganzen Raum verströmen. Seine Anekdoten sind herzerwärmend und unglaublich unterhaltsam, und seine Literatur besteht aus nachhaltig klugen und wichtigen Zeugnissen, die über den Abend hinaus hochliterarische Momente der Poesie schenken.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

 Schmunzeln und Mitgefühl
Schmunzeln und Mitgefühl
„Opa Bär und die Schuhe im Kühlschrank“ von Anne und Paul Maar – Vorlesung 02/26
 Unwiderstehlicher kleiner Drache
Unwiderstehlicher kleiner Drache
„Da ist besetzt!“ von Antje Damm – Vorlesung 02/26
 Glück und Unglück
Glück und Unglück
„Niemands Töchter“ von Judith Hoersch – Literatur 02/26
 Literatur willkommen heißen
Literatur willkommen heißen
„Kindly invited“ am Comedia Theater
 Exzentrik kann zärtlich sein
Exzentrik kann zärtlich sein
„Mitz. Das Pinseläffchen“ von Sigrid Nunez – Textwelten 02/26
 Beziehungen sind unendlich
Beziehungen sind unendlich
„Schwarze Herzen“ von Doug Johnstone – Textwelten 01/26
 Jenseits des Schönheitsdiktats
Jenseits des Schönheitsdiktats
„Verehrung“ von Alice Urciuolo – Textwelten 12/25

„Aggie und der Geist“ von Matthew Forsythe – Vorlesung 11/25
 Allendes Ausflug ins Kinderbuch
Allendes Ausflug ins Kinderbuch
„Perla und der Pirat“ von Isabel Allende – Vorlesung 11/25
 Inmitten des Schweigens
Inmitten des Schweigens
„Aga“ von Agnieszka Lessmann – Literatur 11/25
 Die Liebe und ihre Widersprüche
Die Liebe und ihre Widersprüche
„Tagebuch einer Trennung“ von Lina Scheynius – Textwelten 11/25
 Mut zum Nein
Mut zum Nein
„Nein ist ein wichtiges Wort“ von Bharti Singh – Vorlesung 10/25
Bewusst blind vor Liebe
„Mama & Sam“ von Sarah Kuttner – Literatur 01/26
Nicht die Mehrheit entscheidet
„Acht Jahreszeiten“ von Kathrine Nedrejord – Literatur 12/25