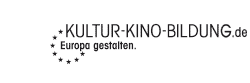Der Blick hinter die Kulissen
Nina Katzenich über Leiharbeit in Ministerien, Lobbyismus und Klüngel - Thema 10/09
choices: Frau Katzenich, gibt es Lobbyismus auf kommunaler Ebene?
Nina Katzenich: Aber natürlich. Wenn es beispielsweise um Infrastruktur oder Bauprojekte geht, lohnt sich Lobbyismus auch dort.
Fällt Klüngeln unter Lobbyismus?
Klüngeln ist ein weiter Begriff. Aber wenn man mithilfe von Bekannten politischen Einfluss ausübt, fällt Klüngeln eindeutig unter Lobbyismus.
Wer interessiert sich für die Arbeit von Lobbycontrol?
Unseren Newsletter haben schon rund 10.000 Interessierte abonniert. Wir hoffen auf noch mehr interessierte Bürgerinnen und Bürger. Inzwischen hat uns auch die Lobbyszene entdeckt. Sie sieht in uns offenbar einen Faktor, mit dem sie rechnen muss.
Warum die Lobbies kontrollieren?
Gut organisierte Interessengruppen beeinflussen heute die Politik enorm. Insbesondere Wirtschaftsverbände und Großkonzerne verfügen oft über einen privilegierten Zugang zur Politik. Sie haben auch die nötigen Ressourcen, um sich gegebenenfalls Verbindungen und professionelle Beratung einzukaufen. Weniger gut ausgestattete Interessen kommen dabei unter die Räder. Deshalb fordern wir ein verpflichtendes Lobbyregister. Dort müssen sich alle, die bei der Politik Lobbying betreiben, mit Namen, Kunden, Budget und Thema eintragen. Bürgerinnen und Bürger sollen zumindest nachvollziehen können, wer mit wie viel Geld politische Entscheidungen beeinflusst.
Ist der Lobbyismus mit der Berliner Republik gewachsen?
Die Zahl der Lobbybüros von Unternehmen ist ebenso gewachsen wie die Zahl der sogenannten Public Affairs- und PR-Agenturen oder die der Politikberatungen. Das liegt weniger daran, dass es früher in Bonn so gemütlich war. Heute betreiben große Unternehmen meist ihr eigenes, individuelles Lobbying, weil die großen Verbände ihre Bindekraft verloren haben. Die Interessen in Sachen politischer Regelungen haben sich sehr diversifiziert.
Lobbycontrol spricht immer wieder von einem „koordinierten Lobbying hinter den Kulissen“.
So ist es. Nehmen Sie das Beispiel, dass über hundert Fachleute, die aus Unternehmen kamen und die von diesen weiter bezahlt wurden, vorübergehend in Bundesministerien gesessen und teilweise an Gesetzen mitformuliert haben, die ihre Arbeitgeber direkt betrafen. Am markantesten ist wohl der Fall eines BASF-Manager, der erst in der Europäischen Kommission und dann im deutschen Wirtschaftsministerium direkt an der Ausarbeitung der EU-Chemikalienrichtlinie „REACH“ beteiligt war. Parallel dazu hat die BASF massiv gegen diese Richtlinie Lobbying betrieben, weil sie zu sehr den Verbraucherschutz betonte. Mit Erfolg: Am Ende schützte die Richtlinie eher die Wirtschaft.
Hat sich bei dieser Leiharbeit jetzt etwas geändert?
Es ist auch weiterhin nicht verboten, dass von Unternehmen bezahlte Mitarbeiter vorübergehend in Ministerien arbeiten. Nur die Regeln dafür sind etwas strenger geworden.
Was unterscheidet Verbände von Lobbies?
„Lobby“ ist einfach der englische Ausdruck für Interessengruppen. Verbände fallen natürlich darunter.
Gehören Lobbyismus und PR zusammen?
Eigentlich ist Lobbyismus etwas, was im Verborgenen stattfindet, PR dagegen eine Strategie, um sich in der Öffentlichkeit ein möglichst positives Image zu schaffen. Inzwischen werden beide Felder oft miteinander verbunden und wirken dann sehr effektiv zusammen. Die Lufthansa hat zum Beispiel hinter den Kulissen massiv gegen die Ausdehnung des Emissionshandels auf den Luftverkehr agitiert. Begleitend dazu hat sie eine großangelegte Kampagne für ihre angeblich immer umweltfreundlichere Technik lanciert.
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?
Als unabhängiges und kostenloses Medium ohne paywall brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wenn Sie unseren verantwortlichen Journalismus finanziell (einmalig oder monatlich) unterstützen möchten, klicken Sie bitte hier.

„Kernziel der Klimaleugner: weltweite Zusammenarbeit zerstören“
Teil 1: Interview – Politologe Dieter Plehwe über die Anti-Klimaschutz-Bewegung
„Nicht versuchen, die Industrie des 19. Jahrhunderts zu retten“
Teil 2: Interview – Meteorologe Karsten Schwanke über Klimaschutz und wirtschaftliche Chancen
„Weit von einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit entfernt“
Teil 3: Interview – Die Rechtswissenschaftlerin Lisa Kadel über die Kriminalisierung von Klimaaktivist:innen
„Dass wir schon so viel wissen, ist das eigentliche Wunder“
Teil 1: Interview – Neurowissenschaftlerin Maria Waltmann über Erforschung und Therapie des Gehirns
„Glaubwürdigkeit ist ein entscheidender Faktor“
Teil 2: Interview – Sprachwissenschaftler Thomas Niehr über Sprache in Politik und Populismus
„Zwischen Perfektionismus und Ungewissheit“
Teil 3: Interview – Psychiater Volker Busch über den Umgang mit schwierigen Entscheidungen
„Je größer das Vermögen, desto geringer der Steuersatz“
Teil 1: Interview – Finanzwende-Referent Lukas Ott über Erbschaftssteuer und Vermögensungleichheit
„Eine neue Ungleichheitsachse“
Teil 2: Interview – Soziologe Martin Heidenreich über Ungleichheit in Deutschland
„Die gesetzliche Rente wird von interessierter Seite schlechtgeredet“
Teil 3: Interview – VdK-Präsidentin Verena Bentele über eine Stärkung des Rentensystems
„Besser fragen: Welche Defensivwaffen brauchen wir?“
Teil 1: Interview – Philosoph Olaf L. Müller über defensive Aufrüstung und gewaltfreien Widerstand
„Als könne man sich nur mit Waffen erfolgreich verteidigen“
Teil 2: Interview – Der Ko-Vorsitzende des Bundes für Soziale Verteidigung über waffenlosen Widerstand
„Das ist viel kollektives Erbe, das unfriedlich ist“
Teil 3: Interview – Johanniter-Integrationsberaterin Jana Goldberg über Erziehung zum Frieden
„Mich hat die Kunst gerettet“
Teil 1: Interview – Der Direktor des Kölner Museum Ludwig über die gesellschaftliche Rolle von Museen
„Ich glaube schon, dass laut zu werden Sinn macht“
Teil 2: Interview – Freie Szene: Die Geschäftsführerin des NRW Landesbüros für Freie Darstellende Künste über Förderkürzungen
„Kultur muss raus ins Getümmel“
Teil 3: Interview – Philosoph Julian Nida-Rümelin über Cancel Culture und Demokratie
„Die Sender sind immer politisch beeinflusst“
Teil 1: Interview – Medienforscher Christoph Classen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
„Das Gefühl, Berichterstattung habe mit dem Alltag wenig zu tun“
Teil 2: Interview – Medienwissenschaftlerin Marlis Prinzing über Haltung und Objektivität im Journalismus
„Nicht das Verteilen von Papier, sondern Journalismus fördern“
Teil 3: Interview – Der Geschäftsführer des DJV-NRW über die wirtschaftliche Krise des Journalismus
„Man hat die demokratischen Jugendlichen nicht beachtet“
Teil 1: Interview – Rechtsextremismus-Experte Michael Nattke über die Radikalisierung von Jugendlichen
„Die Chancen eines Verbotsverfahren sind relativ gut“
Teil 2: Interview – Rechtsextremismus-Forscher Rolf Frankenberger über ein mögliches Verbot der AfD
„Radikalisierung beginnt mit Ungerechtigkeitsgefühlen“
Teil 3: Interview – Sozialpsychologe Andreas Zick über den Rechtsruck der gesellschaftlichen Mitte
„Klimakrisen sind nicht wegzureden“
Teil 1: Interview – Der Ökonom Patrick Velte über die Rückabwicklung von Nachhaltigkeitsregulierungen
„Extrem wichtig, Druck auf die Politik auszuüben“
Teil 2: Interview – NABU-Biodiversitätsexperte Johann Rathke über Natur- und Klimaschutz
„Städte wie vor dem Zweiten Weltkrieg“
Teil 3: Interview – Stadtforscher Constantin Alexander über die Gestaltung von Wohngebieten
„Der Arzt muss dieses Vertrauen würdigen“
Teil 1: Interview – Kommunikationswissenschaftlerin Annegret Hannawa über die Beziehung zwischen Arzt und Patient